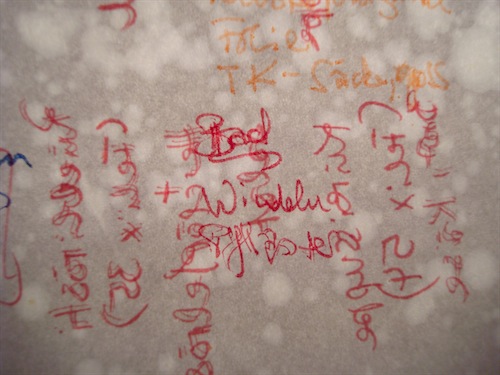Der Abgabetermin für die Endfassung meines Kinderbuches naht und zur Zeit bin ich damit beschäftig, eine Dialektfassung zu schreiben für das Hörbuch. Das bedeutet, dass ich mein Werk Satz für Satz noch einmal durchdenken muss. Und plötzlich finde ich meine Geschichte nur noch doof. Wo ich bis vor ein paar Tagen noch ganz zufrieden war mit meiner Arbeit, sehe ich jetzt nur noch holperige Sätze, schlecht gewählte Ausdrücke und Schwachstellen in der Handlung. Am liebsten würde ich alles noch einmal umschreiben und hin und wieder kommen die Zweifel, ob ich das Wagnis überhaupt hätte eingehen sollen. Was, wenn die Leser mein Buch nicht mögen? Was, wenn sich das Ding nicht verkauft? War ich zu wagemutig, als ich den Vertrag unterschrieben habe? Diese Fragen sind erst der Anfang, das Schlimmste steht mir nämlich noch bevor: Nächstens steht nämlich ein Coiffeurbesuch auf dem Programm, weil ich auf dem Bild ja einigermassen anständig aussehen will. Und dann – der absolute Horror – muss ich mich selber in ein paar kurzen Sätzen so beschreiben, dass die Leser mich nett und sympathisch finden. Während ich kein Problem habe damit, beim Novemberschreiben zehntausende von Wörtern zu schreiben und hier im Blog die Leser vollzuquatschen, bereiten mir die drei oder vier Sätze über mich selber schon jetzt Bauchweh. Und ich muss nicht, wie Ephraim Kishon einen Klappentext schreiben, sondern wirklich nur ein paar Sätze. Aber wie beschreibt man sich selber in ein paar Sätzen auf einem Buch, das hoffentlich auch noch in ein paar Jahren bei zwei oder drei Familien im Bücherregal stehen wird?
Hätte ich nicht den Vertrag unterschrieben, ich würde wohl kalte Füsse bekommen und das Projekt beerdigen. So aber bin ich gezwungen, vorwärts zu gehen und auch wenn ich weiss, dass ich noch zig Schwachstellen entdecken werde, kaum ist das Buch gedruckt, so bin ich doch froh, dass ich jetzt nicht mehr nur darf, sondern auch muss. Denn eigentlich wünsche ich mir ja nichts sehnlicher, als mein „sechstes Kind“ schon bald in die Arme zu schliessen.