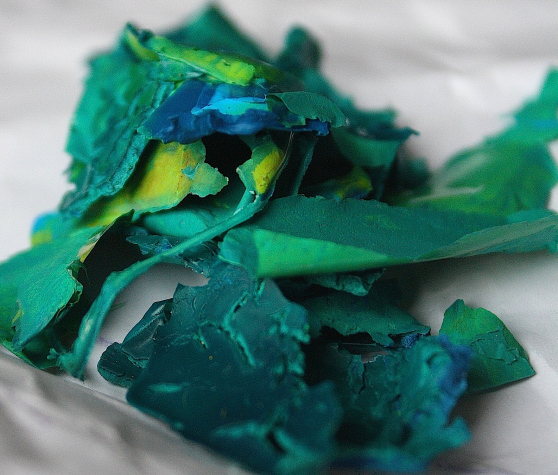Immer mal wieder zwischen 1996 und 2004:
„Eine Putzfrau kommt mir nie ins Haus. Ist doch das Letzte, jemanden die Drecksarbeit machen zu lassen und selber auf der faulen Haut zu liegen. Und nachher motzen, dass sie es nicht recht gemacht hat. Sind doch alles nur verwöhnte Tussis, die sich zu fein sind, selber einen Lappen in die Hand zu nehmen…“
2005, drei Vorschulkinder, ein kürzlich abgeschlossener Umbau, ein Feierabend-Teilzeitjob:
„Manchmal überlege ich mir schon, ob es nicht Zeit wäre, eine Putzfrau einzustellen. Jemand, der einmal pro Woche gründlich sauber macht und ich würde während der übrigen Zeit Schadensbegrenzung betreiben. Aber ob unser Budget das mitmachen würde? Und überhaupt, meine Mama hat es auch ohne hingekriegt und die hatte ein paar Kinder mehr als ich. Ich kann doch nicht einfach jemand anderem meine Drecksarbeit aufbürden.“
Ende 2006, drei Wochen vor dem Geburtstermin, Mutterschaftsurlaub, beginnende Erschöpfung, weil Töchterchen seit zwei Jahren keine Nacht durchschläft:
„Auuuuuutsch!!! Scheissmöbel!!!! Das war mein Zeh!!!!“
Drei Stunden später:
Zeh gebrochen, der Arzt befiehlt Hochlagerung des Fusses und eine Haushalthilfe.
Drei Tage später:
„Es tut mir wirklich schrecklich Leid, dass ich hier faul auf dem Sofa liege, währenddem Sie für mich die Drecksarbeit erledigen müssen, aber ich schaffe es einfach nicht, mehr als fünf Minuten auf den Beinen zu sein. Ach, das ist mir jetzt peinlich, dass Sie auch noch hinter diesem Buffet putzen müssen. Das hätte ich schon längst tun wollen, aber Sie wissen ja, mit drei kleinen Kindern. Und jetzt dieser elende Zeh. Wenn ich Ihnen doch bloss helfen könnte, aber der Arzt hat gesagt…“
Ende Januar 2007, Heimkehr aus dem Spital mit Zoowärter und einem Rezept für mehrere Monate Haushalthilfe:
„Ich bin ja schon froh, dass die Haushalthilfe noch etwas länger bleibt, aber eigentlich müsste ich das jetzt selber schaffen. Ich kann doch nicht immer faul herumliegen. Klar, ich bin müde und der Zoowärter braucht mich rund um die Uhr, aber irgendwie muss ich das doch wieder alleine hinkriegen. Und die Krankenkasse will ja jetzt doch nichts daran zahlen. Also, wir machen das nicht länger als unbedingt nötig.“
Herbst 2007, vier kleine Kinder, ein Feierabend-Teilzeitjob, drei Ehrenämter, keine Haushalthilfe mehr:
„Okay, wir schaffen es nicht ohne. Rufen wir halt die Frau, die das Inserat aufgehängt hat, mal an. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir es eine Weile lang so machen. Zumindest, bis ich die Ehrenämter abgegeben habe.“
Eine Woche später, Samstagmorgen:
„Gut, einmal die Woche, nur putzen, das Aufräumen erledigen wir selber. Schön, dann sehen wir uns nächsten Montag.“
März 2008, vier kleine Kinder, Feierabend-Teilzeitjob aufgegeben, Ehrenämter fast abgegeben, Erschöpfungszustand ärztlich diagnostiziert, ein positiver Schwangerschaftstest:
„Die Putzfrau bleibt, koste es, was es wolle! Und wenn das Baby kommt, muss für die ersten Monate ein Au Pair her, anders schaffe ich das auf keinen Fall.“
Oktober 2008, fünf Kinder, Familienchaos pur:
„Gott sei Dank haben wir eine Putzfrau! Sonst würden wir im Chaos untergehen.“
Bis Frühling 2013 wird sich an dieser Überzeugung nichts mehr ändern.
Herbst 2013, der Familienalltag ist etwas ruhiger geworden, Körper und Seele haben sich von den Strapazen der vergangenen Jahre erholt, der neue Teilzeitjob lässt sich von zu Hause aus erledigen, alle Kinder sind theoretisch gross genug, um selber zu Staubsauger und Putzlappen zu greifen:
„Ich glaube, wir müssen uns allmählich Gedanken darüber machen, ob es nicht auch ohne Putzfrau geht. Die Kinder nehmen das alles viel zu selbstverständlich und ich habe ja jetzt auch wieder mehr Zeit. Aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, sie gehen zu lassen. Klar, sie hat ihre Eigenarten, aber sie ist eine tolle Frau und ich mag sie wirklich.“
Ende 2013, das Familienbudget ächzt unter Weiterbildungskosten, die sich weniger schnell als erwartet bezahlt machen:
„Es geht nicht mehr anders, wir müssen auf die Putzfrau verzichten. Es klappt ja jetzt wirklich ganz ordentlich ohne ihre Hilfe, aber es fällt mir trotzdem unglaublich schwer. Es muss wohl einfach sein… nun ja, vielleicht können wir sie später hin und wieder für den Frühjahrsputz oder andere grössere Einsätze engagieren. So ganz ohne sie ist das ja auch irgendwie schwierig…“
29. Januar 2014:
„Sie muss unbedingt bald einmal zum Kaffee kommen, sag ihr das, wenn sie heute zum letzen Mal kommt. Schade, dass ich nicht zu Hause bin, ich hätte sie so gerne noch einmal gesehen. Du musst sie aber wirklich unbedingt einladen, ich will sie nach all den Jahren doch nicht einfach so ohne irgend eine Anerkennung ziehen lassen. Und ich muss ihr unbedingt noch ein Geschenk besorgen…“

Gefällt mir Wird geladen …