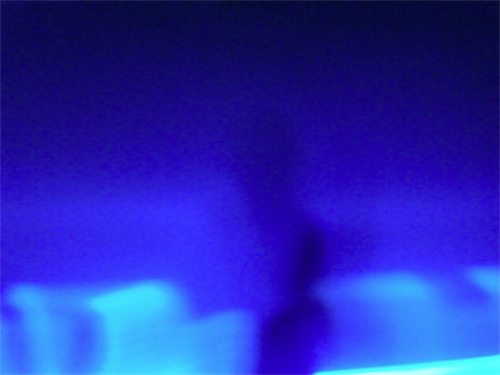Mama Venditti sitzt auf dem Sofa, starrt ins Leere und man könnte meinen, sie würde mal wieder nichts tun. Was natürlich keineswegs stimmt, denn wenn es so aussieht, als würde Mama Venditti nichts tun, dann schreibt es in ihrem Kopf. Nur noch ein paar Momente, dann wird sie sich an den Computer setzen und in die Tasten hauen, was sie sich eben gerade ausgedacht hat. Manchmal aber – in letzter Zeit ziemlich oft – kommt es vor, dass sich der Innere Kritiker zu ihr gesellt, kaum sitzt sie auf dem Sofa und starrt ins Leere. Und dann geraten die zwei sich ins Gehege, die Mama Venditti und der Innere Kritiker:
IK: Was willst du denn heute wieder schreiben?
MV: Nun, ich überlege mir gerade, ob ich vielleicht darüber schreiben soll, dass „Meiner“ und ich uns manchmal wie Brausetabletten verhalten, die….
IK, unterbricht: Wie Brausetabletten? Wie kommst du auf so eine absurde Idee?
MV: Das ist keine absurde Idee. Ich will nur erklären, dass „Meiner“ und ich jeweils keine Grenzen mehr setzen, wenn wir eine Möglichkeit sehen, uns für eine gute Sache einzusetzen. Wir lösen uns dann beinahe auf in der Sache. Genau wie Brausetabletten eben.
IK: Und das soll einer verstehen?
MV: Aber klar. Ich will doch nur darauf hinaus, dass es zwar gut und recht ist, sich für etwas einzusetzen, dass es aber für eine Familie ziemlich belastend werden kann, wenn die Eltern unfähig sind, ihren Idealismus in die Schranken zu weisen.
IK: Das interessiert doch keinen. Das sind eure ganz persönlichen Probleme und auch wenn du dir noch so sehr einredest, bei anderen wäre das ganz ähnlich und du könntest vielleicht dem einen oder anderen Leser einen Gedankenanstoss geben, am Ende werden doch alle den Kopf schütteln ob deines absurden Vergleichs. Brausetabletten, pffff….
MV, schmollt eine Weile, meint dann aber: Vielleicht hast du ja Recht. Das will wohl wirklich niemand lesen. Aber erinnerst du dich noch an meinem Text mit dem Spielplatz? Ich könnte ja darüber schreiben, dass „Meiner“ und ich es noch immer nicht geschafft haben, die Wippe zu verlassen, dass wir immer noch damit beschäftigt sind, einander gegenseitig wieder aufzupäppeln, wenn einer von uns mal wieder unsanft gelandet ist.
IK: Schon wieder „Deiner“ und du. Glaubst du denn wirklich, eure Partnerschaft sei so interessant, dass man darüber lesen möchte?
MV: Nun, vielleicht erkennt sich ja der eine oder andere wieder in dem, was ich hier schreibe.
IK: Ach ja, natürlich. Die Leute werden sich in deinem Geschreibsel wiedererkennen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass es noch andere gibt, die gleich ticken wie ihr zwei?
MV: Okay, dann schreibe ich eben nicht über „Meinen“ und mich, wenn du denkst, dass das die Leute so sehr langweilt. Dann nehme ich halt die Sache mit dem Vertrag, den die Kinder nicht eingehalten haben. Du weisst, dieser Fackel mit dem Versprechen, dass sie in Zukunft jeden Tag ohne Gemecker eine Viertelstunde aufräumen werden. Gestern Abend haben Karlsson und der FeuerwehrRitterRömerPirat doch tatsächlich ihre Unterschriften auf dem Dokument wieder durchgestrichen, damit sie sich nicht an den Vertrag halten müssen.
IK: Darüber kannst du natürlich schon schreiben, wenn du unbedingt deine Unfähigkeit als Mutter vor aller Welt breitschlagen möchtest. Ich finde es ja eher beschämend, dass du es nicht fertig bringst, deinen Kindern ein wenig Sinn für Ordnung beizubringen. Aber wenn es dir nichts ausmacht, Tag für Tag über die gleichen Banalitäten zu schreiben und dich dabei zum Affen zu machen, nur zu! Ich will dir nicht im Wege stehen.
MV, leicht verunsichert: Meinst du wirklich, dass ich mich zum Affen mache?
IK: Aber klar doch. Wenn du mich fragst, dann hast du alles, was in deinem Leben überhaupt erwähnenswert ist, schon längst in irgend einem mittelmässigen Text verwurstet. Demnächst wirst du wohl damit anfangen, über den Inhalt der Prinzchen-Windel zu berichten.
MV: Dann soll ich vielleicht heute gar nichts schreiben? Und morgen auch nicht? Und übermorgen auch nicht?
IK: Das wäre wohl das Beste, aber so, wie ich dich kenne, wirst du schon bald wieder an deinem Bürotisch sitzen und Banalitäten ausbrüten.
MV, zu sich selber: Vielleicht sollte ich das mit dem Schreiben vielleicht wirklich lassen. Zumindest heute. Morgen kann ich ja darüber schreiben, wie sehr mir dieser Innere Kritiker zuweilen zusetzt….
IK, zu sich selber: Natürlich, jetzt soll ich wieder dran Schuld sein, wenn sie nicht schreibt. Als ob nicht sie diejenige wäre, die mit solch hirnverbrannten Ideen kommt, dass man sie einfach kritisieren muss. Brausetabletten! Hat man schon einmal so etwas Bescheuertes gehört?

Gefällt mir Wird geladen …